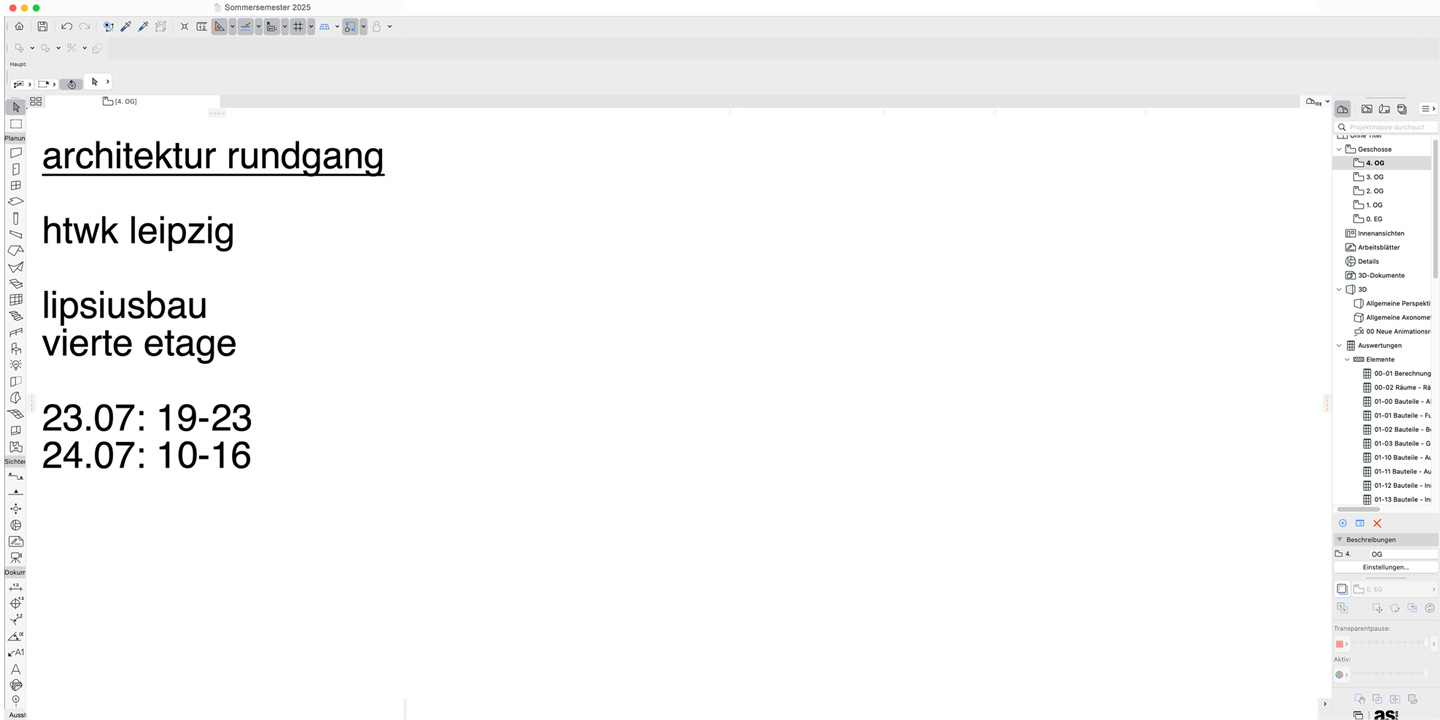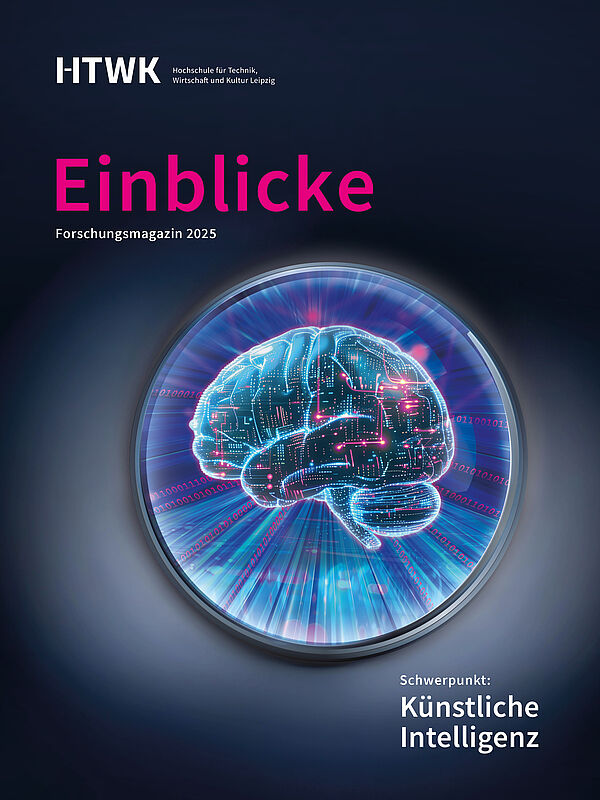Veranstaltungen
Fr., 29. August 2025 / 15.00 Uhr
#frauen entwerfen, bauen, vermitteln... architektur in sachsen – positionen SPECIAL
Anne Femmer, Nora Gitter, Aline Hielscher, Alexander Poetzsch
Vernissage mit Gespräch zu Women and Diversity in Architecture im Stadtbüro Leipzig, Ausstellung vom 02. Juli-29. August 2025
Do., 24. Juli 2025 / 16.00 Uhr
Rundgang & Ausstellung Architektur Sommersemester 2025
Eröffnung des Sommerrundgangs und der Ausstellung der Architekturstudiengänge
Der Zukunftsspeicher Gramzow: AG.RI.KUL.TUR 2030-2050-2100
Ausstellung von architektonischen Entwürfen im SPEICHER GRAMZOW (Uckermark)
Wissenschaftskino zu „Wohnungsmangel und häusliche Gewalt“
Häusliche Gewalt zieht sich durch alle sozialen Schichten. Was kann getan werden, damit mehr sicherer Wohnraum für ein gewaltfreies Leben in Leipzig entsteht? Der Eintritt zur Filmvorführung und Gesprächsrunde ist frei.
Nachrichten
Worum geht es in der neusten Ausgabe?
Im Forschungsmagazin Einblicke 2025 hat Künstliche Intelligenz (KI) zum Schwerpunkt, denn kaum eine technische Errungenschaft hat in jüngster Zeit so viel Aufmerksamkeit erhalten und so tiefgreifend Einzug in verschiedene Lebensbereiche gehalten. Auch in der Forschung spielt KI eine zunehmend tragende Rolle: Sei es als eigener Forschungsgegenstand oder aber als Methode angewandter Forschung, die in diversen Disziplinen neue Ansätze und Möglichkeiten bietet.
Lesen Sie im Magazin beispielsweise, wie die Forschende der HTWK Leipzig KI einsetzen, um menschliche Bewegungsabläufe zu analysieren - sei es im Sport, in der Medizin oder bei Arbeitsabläufen. Auch ein Messsystem für die Wartung von Straßen entwickeln Forschende aus dem Zusammenspiel von Sensoren und KI. A propos Straße: Das Smart-Driving-Team der HTWK Leipzig erprobt an Modellfahrzeugen verschiedene KI-Ansätze zum autonomen Fahren - wir berichten.
Themenvielfalt
Neben der Forschungsstatistik 2024 finden Sie wie immer auch die Gewinnerbilder des Fotowettbewerbs Forschungsperspektiven sowie in den "Schlaglichtern" viele weitere spannende Einblicke in unsere vielfältigen Forschungsthemen. Seien es die Bauingenieure und Architekten um Prof. Dr.-Ing Alexander Stahr, die ein neues Reallabor für den Holzbau der Zukunft errichteten, die Maschinenbauer um Prof. Dr.-Ing. Stephan Schönfelder, die UVC-Strahlen zur Luftreinigung verwenden und die Ausbreitung der Keime in Klassenzimmern simulieren, das Team von Prof. Dr.-Ing. Klaus Holschemacher, das recycelten Carbonbeton entwickelt oder aber Prof. Dr.-Ing. Robert Böhm, der mit seinen Mitarbeitenden Methoden erprobt, um Verbundwerkstoffe aus der Luftfahrt und aus Windkraftanlagen wiederzuverwenden.
Das Forschungsmagazin der HTWK Leipzig wird aus Mitteln des Projekts Saxony⁵ mitfinanziert, das im Rahmen des Bund-Länder-Programms Innovative Hochschule gefördert wird.
Keine Ausgabe mehr verpassen
Gern können Sie kostenfrei die Einblicke postalisch oder digital abonnieren. Die Einblicke erscheint einmal im Jahr.
Viel Lesevergnügen wünscht Ihnen die Einblicke-Redaktion des Referats Forschung der HTWK Leipzig!
Mit seinem Wirken stärkt Stahr die Bedeutung Leipzigs und Sachsens im nachhaltigen und innovativen Holzbau. Als promovierter Bauingenieur, der seit 2010 Professor an der HTWK Leipzig ist, hat er insbesondere in der angewandten Forschung zu digital basierten Fertigungskonzepten und in der Architekturlehre neue Maßstäbe gesetzt. Kern ist sein anwendungsbezogener Forschungsansatz, der den architektonischen Entwurf, die ingenieurtechnische Planung und die numerisch gestützte Fertigung zusammenbringt. Ziel ist es, mit Systeminnovationen Lücken zwischen einzelnen Fachdisziplinen bzw. Prozessschritten zu schließen – und das Bauen von Grund auf ganzheitlich zu gestalten: „Um in Zukunft klimaschonend zu bauen, bedarf es dringend innovativer Konzepte, welche die Materialverbräuche senken, die Nutzungszeiten der Bauwerke durch höhere Ausführungsqualitäten verlängern und den Einsatz kaum recyclingfähiger mineralischer Baustoffe reduzieren. Darin sehe ich auch meine besondere Verantwortung als Wissenschaftler“, beschreibt Stahr seine Motivation.
Prof. Dr.-Ing. Jean- Alexander Müller, Rektor der HTWK Leipzig, betont: „Die unermüdliche Arbeit von Alexander Stahr erfährt durch den Leipziger Wissenschaftspreis eine angemessene öffentliche Würdigung. Seine Forschung zum klimafreundlichen und zukunftsfähigen Bauen hat großen Anwendungsbezug und strahlt über HTWK und Stadt Leipzig hinaus. Damit hat sie das Potenzial, Leipzig und die Region voranzubringen. Alexander Stahr steht damit zugleich exemplarisch für die Leistungsfähigkeit und Qualität von Lehre und Forschung an unserer Hochschule für angewandte Wissenschaften.“
Forschungsgruppe FLEX: Forschen, Lehren und Experimentieren
Ein zentrales Element in Stahrs bundesweit und international beachtetem Schaffen hier in Leipzig ist die interdisziplinäre Forschungsgruppe FLEX, die er 2014 ins Leben rief. Er und sein Team entwickeln neue Lösungen an der Schnittstelle von digitaler Planung und Fertigung. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Praxispartnern hat das Team bereits mehr als 20 Forschungsprojekte umgesetzt.
HolzBauForschungsZentrum
Zu den Meilensteinen gehört die Eröffnung des HolzBauForschungsZentrum Leipzig im Innovationspark Bautechnik Leipzig/Sachsen im Stadtteil Engelsdorf 2024. In der hochmodernen Forschungshalle sollen Grundlagen für Hersteller- und Bauprodukt-unabhängige Fertigungskonzepte für das digital basierte Bauen der Zukunft mit Holz entwickelt werden. Damit wird sowohl lokal als auch regional, national und international eine Lücke geschlossen. Im HolzBauForschungsZentrum entwickeln Stahr und sein Team Lösungen für das Bauen mit vorgefertigten Teilen aus nachwachsenden Rohstoffen im Anwendungsmaßstab.
Regional vernetzt
Die enge Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Region bildet einen Schwerpunkt für Stahr und FLEX, um Konzepte in der Praxis zu evaluieren und fehlerhafte Annahmen schnell korrigieren zu können. Seit 2018 engagiert er sich im sächsischen Transferverbund Saxony5 der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Im Anwendungsbereich „Produktion“ setzt er sich dort besonders für den Transfer von Wissen zu digital basierten Fertigungskonzepten in Architektur und Bautechnik ein.
Der Leipziger Wissenschaftspreis
Den Wissenschaftspreis verleihen seit 2001 die Stadt Leipzig, die Universität Leipzig sowie die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig alle zwei Jahre an Persönlichkeiten aus der Wissenschaft, deren Arbeiten höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und Leipzigs Ruf als Stadt der Wissenschaften festigen.
Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger des Leipziger Wissenschaftspreises waren beispielsweise Prof. Dr. Christian Wirth, Professor für spezielle Botanik und funktionelle Biodiversität (2022), Prof. Dr. Evamarie Hey-Hawkins, Professorin für Anorganische Chemie an der Universität Leipzig (2019), Prof. Dr. Dan Diner, Direktor des Simon-Dubnow-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur an der Universität Leipzig (2013) sowie Prof. Dr. Svante Pääbo, Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (2003), der 2022 den Nobelpreis für Physiologie und Medizin erhielt.